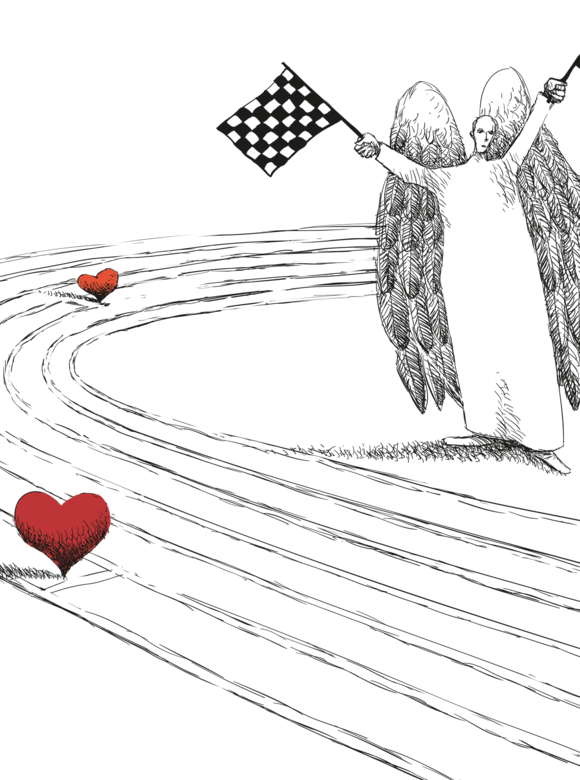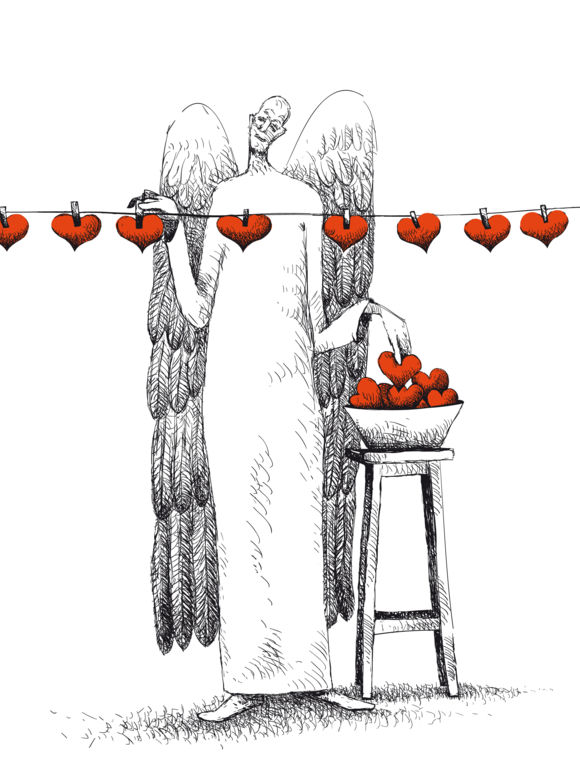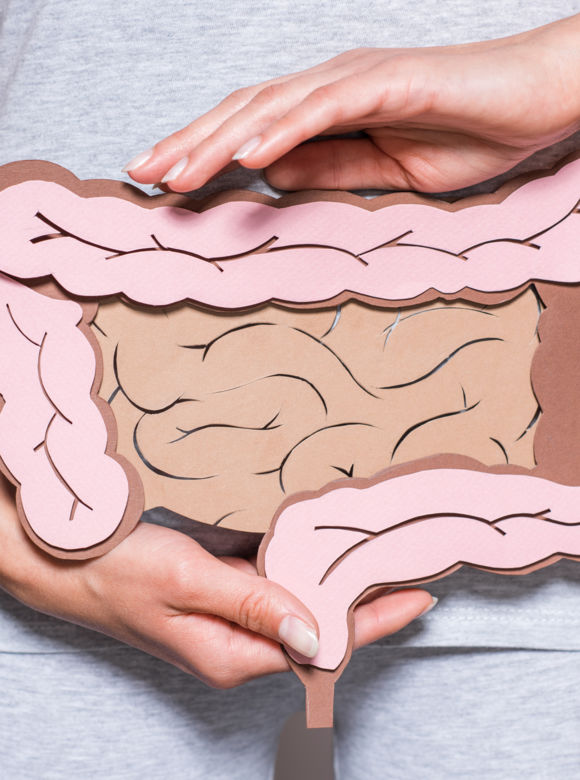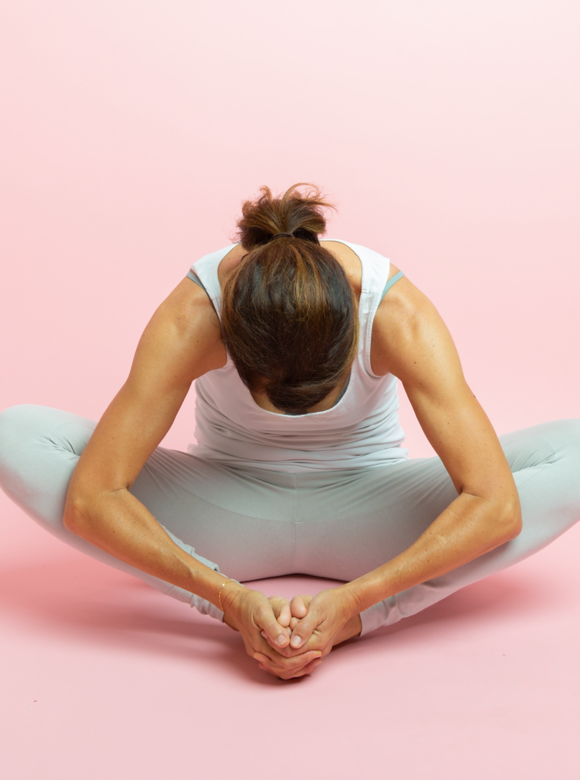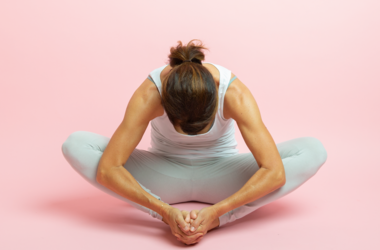Die Existenzweise des Seins
Text: Michael Stavarič
Der Philosoph Erich Fromm notierte einst, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich vollständig dem Besitz und Profitstreben verschrieben habe – deshalb sähen wir auch selten ein Beispiel für die „Existenzweise des Seins“, weil sich die Mehrheiten an der „Existenzweise des Habens“ orientieren. Das „Sein“, demnach etwa das Reisen und Verweilen, Erfahrungen, Begegnungen, Betrachtungen, Gespräche etc. als den wertvolleren Anteil unseres Lebens zu erachten, diese Haltung ginge zusehends verloren. Ich sehe schon lange, dass der materielle Besitz und die Gier nach noch mehr von dieser Habe (im übertragenen Sinne auch Macht etc.) offenkundig und allgegenwärtig sind; dieser „Besitz“, das Haben (und oft genug ein damit verbundenes Gehabe), bleibt nicht zuletzt eine Brutstätte von Ängsten, es mangelt darin an nachhaltigen Identitäts- und Sinnstiftungen.
Ich glaube zutiefst daran, dass sich ein jeder von uns auf eine Reise (innerlich wie äußerlich) begeben muss, um später anderen davon zu erzählen; nicht ausschließlich darüber, was man gesehen und gespürt, vielmehr auch davon, wie es einen verändert und transformiert hat. Als Vielgereister kenne ich unzählige Orte und Hotelzimmer, sie alle üben eine Wirkung auf mich aus, vielfach ist diese eher „neutral“; man kommt, verweilt und reist weiter, ohne jemals wieder an die besagte Bleibe zurückzudenken. Mitunter ist man an Orten, in Hotelanlagen, die einen zutiefst anwidern, die etwas ausstrahlen und repräsentieren, das so gar nicht mit einem selbst konform geht (an diese Stätten denkt man öfter zurück, als man möchte), und, traurig genug, ganz selten nur ist man tatsächlich irgendwo angekommen, fühlt sich angenommen und möchte bleiben, aus vielerlei Gründen: wegen der Aussicht, des Interieurs, der Stimmung, schlicht dem genus loci… an solchen Orten manifestiert sich für mich auch diese Lust auf „Sein“.
Das tschechische Wort für Reise, „cesta“, stammt übrigens von einem slawischen „cestiti“ ab, also einem heutigen „cistit“, „reinigen“, „klären“, doch im übertragenen Sinne schwingt selbstverständlich das „Reine“ und „Klare“ mit; der Weg, die Reise als Offenbarung, Erkenntnis und Überwindung seiner selbst; das Verschmutzte, das Belastende fällt gleichsam von einem ab, das Reisen wird darin zur rituellen Reinigung. Die Ankunft an einem mit einer solchen Reise korrespondierenden Ort, es ist tatsächlich ein großes Glück, denn ein Mensch will irgendwo ankommen dürfen, Kraft tanken und zur Ruhe kommen.
Am Anfang seines Buches „Voyages de philosophes et philosophies du voyage“ verfolgt ein gewisser Lucien Guirlinger nicht ohne Absicht die Etymologie des französischen Begriffs der Reise (voyage). „Voyage“ sei, wie übrigens auch das italienische „viaggio“, vom lateinischen „via“ hergeleitet, und beinhalte das „auf dem Weg sein“. Noch direkter ließe sich „voyage“ auf „veiage“ zurückführen, ein französisches Wort des 11. Jahrhunderts, dessen Akzent mehr auf dem Weg, der zurückzulegen ist, als auf dem Gehen oder Fahren selbst liegt; Sie erinnern sich gewiss an die Plattitüde: Der Weg ist das Ziel.
Die Bedeutung von „voyage“ – als Fahrt zu einem entfernteren Ort, die ab dem 15. Jahrhundert anzutreffen ist, stellt nach Guirlingers Ansicht eine unzureichende Definition im Französischen dar, weil sie die Reise auf eine räumliche Bewegung bzw. eine objektive, materielle Realität reduziert, während die Reise doch vor allem auch eine Geisteshaltung sein muss.
Der deutsche Begriff „Reise“, aus dem Vordeutschen „raiso“‚ „Aufbruch“, Reise bzw. Losgang“, ist abgeleitet vom gemeingermanischen Verb „reisa“ und bedeutet „aufgehen, sich erheben“ (wie die Sonne, im Englischen!). Die Ausgangsbedeutung von „Reise“ ist also eine andere als diejenige von „voyage“ und weist in die Richtung von „ausreißen“, „von etwas weg wollen“ – das Tschechische scheint mir jedenfalls die sprachlichen Konnotationen des Französischen und des Deutschen zu vereinen. Das englische „travel“ wiederum hängt mit dem französischen „travail“ (Arbeit) zusammen; beide Worte haben eine gemeinsame Quelle: das lateinische „trepalium“, welches ein Folterinstrument bezeichnete und ergo irgendwann auch zum Synonym für Folter („torture“ etc.) wurde. Es wanderte später in das Altfranzösische als ein „travailler“ und nahm dort die Bedeutung von „peinvoller, harter Arbeit“ an. Letztere Bedeutung von „travailler“ übernahm wiederum das Englische, wandelte diese aber schnell zu einem „travel“ im Sinne von „wearisome journey“ (ermüdende Reise). Wahrscheinlich war dies den vielen Schwierigkeiten geschuldet, die ein Unterwegs-Sein früher, denken wir nur an die Zeiten Homers, Shakespeares oder Goethes, mit sich brachte.
Reisen ist also, wenn ich dies mit Hilfe dieser Sprachen subsumiere, zunächst eine „ermüdende Folter“, ein „Ausreißen“ und „Wegwollen“, ein „auf dem Weg sein“ (nicht unbedingt, um irgendein Ziel erreichen zu wollen), eine „räumliche Überbrückung von Entfernungen“, und – dem Tschechischen sei dank – eine innere Reinigung, ja Läuterung; hier hätte Guirlinger auch seine etymologische Entsprechung einer „Geisteshaltung“ entdecken können, die andere Sprachen missen lassen.
Michel Serres – um einen weiteren Referenzpunkt zu wählen – schlägt in seiner JulesVerne-Interpretation „Jouvences. Sur Jules Verne“ vor, dass eine authentische Reise unbedingt drei Komponenten beinhalten muss: Jede Reise sei erstens eine Bewegung im Raum und ziele auf die Entdeckung der Welt ab. Sie sei zweitens auch immer eine wissenschaftliche Forschungsreise bzw. allgemein von einem Streben nach Wissen begleitet. Sie trage drittens auch die Züge einer metaphysischen Reise oder zumindest einer für die eigene Persönlichkeit bereichernden Initiationsreise.
Worauf ich damit aber eigentlich hinweisen will: Eine Reise zur Rickatschwende ist nicht irgendeine „Anreise“, man kann und darf sich ruhig schon vorab mit dem/seinem Sein befassen; möglicherweise ist es ja auch irgendwo inspirierend, sich mit besagten, meinen Überlegungen zum (An-)Reisen und dem Reisebegriff selbst auseinanderzusetzen. All das nämlich widerspricht der „Existenzweise des Habens“ – und ich meine, damit sind Sie, werte Leserinnen und Leser, vor Ort schon mal auf der richtigen Spur.
Und – falls es Sie möglicherweise darüber hinaus interessiert – ich sehe in all diesen Komponenten und Ingredienzien, die eine Reise tatsächlich zu einer solchen machen, zugleich Grundbedingungen einer literarischen Äußerung: das Reisen und die Literatur hängen selbstverständlich eng zusammen. Vielleicht war dies mit ein Grund, warum ich mich schon als Kind/Jugendlicher für literarische Charaktere (und Autoren) interessierte, die sich auf den Weg gemacht hatten; die sowohl eine innere Haltung, eine Art Reisefieber aufwiesen, wie auch äußerlich ihre Literatur (und Protagonisten) mit allerlei Bezugspunkten der Welt, ihren Abenteuern und Wesenheiten ausstatteten.
Im Reisen erkenne ich den Ursprung aller von uns erzählten und aufnotierten Geschichten, die Literatur stellt für mich daher selbstverständlich auch die Option einer Reinigung dar; das Wort, das läutert und der Satz, der uns lossagt von unserer Vergangenheit. Das Lesen ist also stets ein Aufbruch in eine unbekannte Welt; wir bewegen uns innerlich, sind möglicherweise alsdann von der gelesenen Literatur bewegt, das tatsächliche Reisen in seiner äußerlichen Form folgt unweigerlich.
Als Autor frage ich mich ja ständig, wer ich bin, wer meine Protagonisten in all den bereits geschriebenen Büchern sind. Ich frage mich, was in uns allen steckt, was uns ausmacht, was unser „Sein“ ist und wie unser Leben beschaffen sein sollte. Die Charaktere, die man dabei schafft, dienen vielfach eher als Mahnung, weil man nicht wie diese sein, nicht so enden möchte – man wünscht für sich ein besseres, anderes Leben, das sich definitiv an der „Existenzweise des Seins“ orientiert. Einen anderen, lohnenswerteren Weg gibt es nicht.

weitere Angebote
Das Magazin des Rickatschwende F. X. Mayr Health Retreat 2018